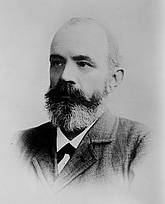Identitätsstiftung
Im 19. Jahrhundert hatte sich ein ländliches Bildungsbürgertum, dem Lehrer, Pfarrer und andere Akademiker angehörten, darum bemüht, im jungen Kanton Basel-Landschaft Identität zu stiften. Sie hatten ein reiches Vereinsleben angeregt, das Brauchtum gefördert und Heimatkunde betrieben. Aufgrund ihres Wirkens setzte sich in den Köpfen der Menschen das Bild eines ländlichen und eigenwilligen Kantons fest. Ende des 19. Jahrhunderts fasste Wilhelm Senn dieses Selbstverständnis im Baselbieter Lied prägnant zusammen. Zeitweise festigten sich die Vorstellungen vom Baselbiet auch durch die Ausgrenzung des Fremden. Wer dem Bild vom echten Baselbieter nicht zu entsprechen schien, stiess bei eingefleischten Lokalpatrioten auf Ablehnung. So erging es Leuten aus der benachbarten Stadt Basel, Ausländern oder nicht angepassten Einheimischen. Das Selbstbild vom ländlichen Kanton hielt sich auch in der Nachkriegszeit. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ob auswärts oder an Festanlässen innerhalb seiner Grenzen, setzte sich der Kanton mit Landwirtschaft und Posamenterei, mit Kirschen und Kirsch, mit Lärm und Feuer in Szene.(1) Noch 1982 eröffnete Landratspräsident Max Mundwiler die Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen des Kantons, indem er aus dem Baselbieter Lied zitierte. Und die Feier klang aus, indem die Festgemeinde die Kantonshymne anstimmte.(2) Kräftige Nahrung erhielt das Bild vom ländlichen und eigensinnigen Baselbiet auch während der langen Auseinandersetzung um die Wiedervereinigung.
(1) Dominik Wunderlin: Chluri und Chirsi – ein Beitrag zur Selbstdarstellung des Baselbiets, in: Baselbieter Heimatbuch 18, 1991, S. 41-54
(2) Hans Handschin: 150 Jahre Kanton Basel-Landschaft, in: Baselbieter Heimatbuch 15, 1986, S. 9-28
Ergänzende Texte zum Thema
Zum Thema: Weitere Texte aus anderen Rubriken
Zu dieser Zeit: Weitere Texte aus anderen Rubriken
Derselbe Ort: Weitere Texte aus anderen Rubriken
-
 Erste Siedlungen
Erste Siedlungen
-
 Vom Herrenhof zur Kleinstadt
Vom Herrenhof zur Kleinstadt
-
 Adel und Burgen
Adel und Burgen
-
 Beziehungen zwischen Stadt und Land
Beziehungen zwischen Stadt und Land
-
 Reformation und Staatskirche
Reformation und Staatskirche
-
 Dorfkäserei
Dorfkäserei
-
 Konsum
Konsum
-
 Romantik im Oberwiler Pfarrhaus
Romantik im Oberwiler Pfarrhaus
-
 Ländliche Untertanen
Ländliche Untertanen
-
 Herrschaftskrisen und Revolution
Herrschaftskrisen und Revolution
-
 Die Bauernkriege von 1525 und 1653
Die Bauernkriege von 1525 und 1653
-
 Die Basler Revolution von 1798
Die Basler Revolution von 1798
-
 Die Akteure der Revolution von 1798
Die Akteure der Revolution von 1798
-
 Prattler Fasnacht
Prattler Fasnacht
-
 Dichterpfarrer
Dichterpfarrer
-
 Niklaus Brodbeck: Kampf für eine gerechte Verfassung
Niklaus Brodbeck: Kampf für eine gerechte Verfassung
-
 Wilhelm Hoch: besonnen revolutionieren
Wilhelm Hoch: besonnen revolutionieren
-
 Hans Stehlin: vom Revolutionär zum Restaurator
Hans Stehlin: vom Revolutionär zum Restaurator
-
 Stephan Gutzwiller: Agent des Aufbaus
Stephan Gutzwiller: Agent des Aufbaus
-
 Johann Walser: Leben in der Opposition
Johann Walser: Leben in der Opposition
-
 Benedikt Banga: der erste Kultur- und Bildungspolitiker
Benedikt Banga: der erste Kultur- und Bildungspolitiker
-
 Johann Hug: vermitteln zwischen den Fronten
Johann Hug: vermitteln zwischen den Fronten
-
 Niklaus Singeisen: von der Stadt aus fürs Land
Niklaus Singeisen: von der Stadt aus fürs Land
-
 Heinrich Völlmin: für die Demokratie agitieren
Heinrich Völlmin: für die Demokratie agitieren
-
 Martin Birmann: den Bedürftigen helfen
Martin Birmann: den Bedürftigen helfen
-
 Emil Remigius Frey: alles für das Volk
Emil Remigius Frey: alles für das Volk
-
 Gustav Bay: Schule und Kirche reformieren
Gustav Bay: Schule und Kirche reformieren
-
 Martin Bider: die Provinz erschliessen
Martin Bider: die Provinz erschliessen
-
 Kapital aus der Stadt
Kapital aus der Stadt
-
 Der Kanton und die Industrialisierung
Der Kanton und die Industrialisierung
-
 Wohnen im Industriezeitalter
Wohnen im Industriezeitalter
-
 Frauenarbeit
Frauenarbeit
-
 Heimarbeit neben Fabrikarbeit
Heimarbeit neben Fabrikarbeit
-
 Essen gegen Arbeit
Essen gegen Arbeit
-
 Migros und ACV am Pranger
Migros und ACV am Pranger
-
 Angst vor Kriminalität und Anarchismus
Angst vor Kriminalität und Anarchismus
-
 Wirtschaftseinbruch
Wirtschaftseinbruch
-
 Uhrenindustrie
Uhrenindustrie
-
 Überforderte Vororts-Gemeinden
Überforderte Vororts-Gemeinden
-
 Mit dem Velo zur Arbeit
Mit dem Velo zur Arbeit
-
 Bahnboykott
Bahnboykott
-
 Bau von Gymnasien
Bau von Gymnasien
-
 Drängende Spitalfrage
Drängende Spitalfrage
-
 Spitalbau-Politik mit regionaler Ausrichtung
Spitalbau-Politik mit regionaler Ausrichtung
-
 Baselland wird Gewässerschutzpionier
Baselland wird Gewässerschutzpionier
-
 Vermittlung zwischen Bevölkerung und Regierung
Vermittlung zwischen Bevölkerung und Regierung
-
 Der Revolutionär aus dem Oristal
Der Revolutionär aus dem Oristal
-
 Basel tickt anders
Basel tickt anders
-
 Revolutionsstimmung
Revolutionsstimmung
-
 Rückschritt und Aufbruch
Rückschritt und Aufbruch
-
 Neubürgerkrieg
Neubürgerkrieg
-
 Ein Revolutionär aus Basel
Ein Revolutionär aus Basel
-
 Die Republik von Diepflingen
Die Republik von Diepflingen
-
 Blutige Eskalation an der Hülftenschanze
Blutige Eskalation an der Hülftenschanze
-
 Eingreifen der Tagsatzung
Eingreifen der Tagsatzung
-
 Wunsch nach Gleichberechtigung
Wunsch nach Gleichberechtigung
-
 Blutige Bilanz
Blutige Bilanz
-
 Der Bau der Eisenbahnlinie Basel-Olten
Der Bau der Eisenbahnlinie Basel-Olten
-
 Die Mobilität siegt
Die Mobilität siegt
-
 Kampf um die Linienführung
Kampf um die Linienführung
-
 Bahnfieber
Bahnfieber
-
 Der Gemeindejoggeli-Putsch
Der Gemeindejoggeli-Putsch
-
 Martin Birmann-Socin (1828–1890)
Martin Birmann-Socin (1828–1890)
-
 Stephan Gschwind-Stingelin (1854-1904)
Stephan Gschwind-Stingelin (1854-1904)
-
 Strukturwandel und neue Staatsaufgaben
Strukturwandel und neue Staatsaufgaben
-
 Oppositionelle Bewegungen
Oppositionelle Bewegungen
-
 Umstrittene Initiative
Umstrittene Initiative
-
 Anstoss von Links
Anstoss von Links
-
 Der Wiedervereinigungsverband
Der Wiedervereinigungsverband
-
 Arbeitsteilung in Stadt und Land
Arbeitsteilung in Stadt und Land
-
 Bewegung am linken Rand
Bewegung am linken Rand
-
 Generalstreik in Basel
Generalstreik in Basel
-
 Die ausländische Bevölkerung
Die ausländische Bevölkerung
-
 Mädchenanstalt
Mädchenanstalt
-
 Der schlechte Einfluss des Stadtlebens
Der schlechte Einfluss des Stadtlebens
-
 Kein Armenkanton
Kein Armenkanton
-
 Abgeschoben
Abgeschoben
-
 Schule schwänzen
Schule schwänzen
-
 Mittelschulen
Mittelschulen
-
 Benachteiligung der Lehrerinnen
Benachteiligung der Lehrerinnen
-
 Der Schulinspektor
Der Schulinspektor
-
 Ende des Provisoriums
Ende des Provisoriums
-
 Flüchtlingsschicksal
Flüchtlingsschicksal
-
 Das Kriegsende 1945
Das Kriegsende 1945
-
 Luftschutz
Luftschutz
-
 Franzosenfurcht und Kriegstourismus
Franzosenfurcht und Kriegstourismus
-
 Eisenbahnnetz
Eisenbahnnetz
-
 Autobahnpläne
Autobahnpläne
-
 Mobiler Lebensstil
Mobiler Lebensstil
-
 Ausbau des Autobus-Liniennetzes
Ausbau des Autobus-Liniennetzes
-
 Alternative Jugendkulturen
Alternative Jugendkulturen
-
 Unterschiede unter Migranten
Unterschiede unter Migranten
-
 Waggis
Waggis
-
 Letzter Appell
Letzter Appell
-
 Tollkühne Männer in fliegenden Kisten
Tollkühne Männer in fliegenden Kisten
-
 Juden
Juden
-
 Flötenkonzert auf dem Tanzboden
Flötenkonzert auf dem Tanzboden
-
 Stadt und Land
Stadt und Land
-
 Patriotische Gesänge
Patriotische Gesänge
-
 Marie Lotz
Marie Lotz
-
 Im Schatten der Männer
Im Schatten der Männer
-
 Regionale und internationale Kulturpolitik
Regionale und internationale Kulturpolitik
-
 Walter Eglin
Walter Eglin
-
 Historienmalerei
Historienmalerei
-
 «Volks-Kultur»
«Volks-Kultur»
-
 Bezug zur Stadt
Bezug zur Stadt
-
 Wilhelm Balmer
Wilhelm Balmer
-
 Salonkultur
Salonkultur
-
 Ländliches Bildungsbürgertum
Ländliches Bildungsbürgertum
-
 Ein gescheitertes Sesselbahnprojekt
Ein gescheitertes Sesselbahnprojekt
-
 Viele Konfliktparteien
Viele Konfliktparteien
-
 Korallenriffe und Muscheln
Korallenriffe und Muscheln